Im Beitrag:
1. Mogersdorf und die Türkenkriege
Im südlichen Burgenland befindet sich im Bezirk Jennersdorf an der Grenze zu Ungarn die Marktgemeinde Mogersdorf. Der Ort wurde durch seine Grenzlage geprägt (Mogersdorf ist heute die östlichste Gemeinde Österreichs im Raabtal) und erlangte durch die Schlacht bei Mogersdorf im Jahr 1664 historische Bedeutung. Heute erinnern in Mogersdorf mehrere Gedenkstätten unterschiedlichster Art an den bedeutsamen Sieg über die Türken, von denen die Gedenkstätte auf dem Schlösslberg die bekannteste ist.
2. Historischer Kontext: die Schlacht bei Mogersdorf
Die Gedächtnisstätte auf dem Schlösslberg wurde zur Erinnerung an die Schlacht bei Mogersdorf am 1. August 1664 errichtet, die als das wichtigste Gefecht im 4. Österreichischen Türkenkrieg (Türkenkrieg von 1663/1664) gilt. In dem zwischen Mogersdorf und dem Zisterzienserkloster St. Gotthard an der Raab stattfindendem Gefecht wurde der Vormarsch osmanischer Truppen gegen Wien aufgehalten und der Grundstein für den nur neun Tage danach unterzeichneten Frieden von Eisenburg gelegt. Die Bedeutung der Schlacht bei Mogersdorf wird in einem breiteren historischen Kontext deutlich: Der Türkenkrieg von 1663/1664 war der erste große Türkenkrieg seit 1606 und der Frieden von Eisenburg dauerte bis zum Ausbruch des Großen Türkenkrieges (5. Österreichischer Türkenkrieg) im Jahre 1683. Viele bedeutende Adelsfamilien im Königlichen Ungarn und Kroatien waren mit dem Verhalten des Kaisers Leopold I. nach der Schlacht bei Mogersdorf unzufrieden, denn sie meinten, er hätte den Sieg ausnutzen sollen, statt einen unvorteilhaften Frieden zu schließen. Das war der Auslöser für die große Magnatenverschwörung von 1664 bis 1671.
3. Gedenkstätte auf dem Schlösslberg
3.1 Errichtung der Gedenkstätte
Die Gedenkstätte auf dem Schlösslberg wurde 1964 anlässlich des Jubiläums „300 Jahre seit der Türkenschlacht 1.8.1664“ errichtet. Der Schlösslberg ist die letzte Erhebung im Gebiet zwischen Raab und Lafnitz und erlaubt einen freien Blick weit ins benachbarte Ungarn hinein. Dies macht den Hügel zu einem strategisch wichtigen Punkt, der in der Schlacht bei Mogersdorf als Feldherrenhügel des christlichen Heeres diente.
Der Schlösslberg war ein Weinberg der Zisterzienser von St. Gotthard. Auf dem Hügel stand ein Meierhof des Klosters und daneben soll sich mindestens seit dem 15. Jh. auch eine Kapelle befunden haben. Die Kapelle wurde 1897 in neugotischem Stil umgebaut und 1945 teilweise zerstört. Die Errichtung einer neuen Kapelle am Schlösslberg war auch ein Motiv für die Jubiläumsfeierlichkeiten (anlässlich der 300-Jahr-Feier der Türkenschlacht wurde Mogersdorf auch zur Marktgemeinde erhoben). Für die Errichtung des Mahnmals wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, den der Wiener Architekt Ottokar Uhl gewinnen konnte. Ottokar Uhl (1931-2011) machte sich einen Namen im Sakralbau nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und war Träger zahlreicher Auszeichnungen, unter anderem des Österreichischen Staatspreises für Architektur, des Österreichischen Bauherrenpreises und des Kardinal-Innitzer-Würdigungspreises. Die Gedenkstätte wurde mit Unterstützung des Bundes, des Landes Burgenland und der gesamten burgenländischen Bevölkerung auf dem von der Diözese Eisenstadt bereitgestellten Platz errichtet.
Die Gedenkstätte wird mit einem Gedenkstein eröffnet, hinter dem zwei quadratisch geschnittene Heckenlinien den Schlösslberg hinauf führen, wo sich die neue Kapelle und ein weithin sichtbares Betonkreuz befinden.
3.2 Schlösslkapelle und Betonkreuz
Die Schlösslkapelle wurde 1964 nach fast 20 Jahren Ruinendasein wieder aufgebaut. Daneben steht ein 15 Meter hohes, die Landschaft dominierendes Betonkreuz. Beide Elemente bilden eine ausdrucksvolle Einheit. Kapelle und Kreuz wurden am 2. August 1964 geweiht. Sie sollen ein Zeugnis der Bereitschaft zu Toleranz und Frieden sein und die Botschaft von der Freiheit und Würde des Menschen verkünden.
Die neue Kapelle auf dem Schlösslberg wurde in einem modernen Stil als schlichter, weiß getünchter Kubus erbaut. Darin befand sich seit 1965 ein Altartriptychon des Künstlers Herbert Böckl. Doch bereits nach einigen Jahren musste dieser sog. Liebfrauenaltar wegen Problemen mit der Innentemperatur wieder entfernt werden. An seiner Stelle wurde 1976 ein Altarbild von Rudolf Kedl aufgestellt, auf dessen Reliefplatten Tod, Auferstehung und Leben dargestellt sind. Das aus Kupfer getriebene Kirchentor zeigt zwölf biblische Geschehnisse (Erschaffung der Erde, Arche Noah usw.).
4. Friedensweg Schlösslberg
Im Gedenken an eine Schlacht soll heute nicht mehr über Sieg und Niederlage nachgedacht werden, sondern das Ereignis soll Anlass dafür sein, sich über die Vermeidung von Konflikten auseinanderzusetzen. In diesem Sinne wurde der Friedensweg Schlösslberg geschaffen. Der als Themenweg für die ganze Familie konzipierte Friedensweg ist Teil des Naturparks Raab-Örség-Goricko und soll den Besuchern die Ideen von kulturübergreifender Toleranz und Frieden näher bringen.
4.1 Gedenkraum 1664 im Kreuzstadel
Am Anfang des Friedensweges steht der "Gedenkraum 1664" im Kreuzstadel. Der Kreuzstadel ist ein alter, in Blockbauweise errichteter und mit Stroh gedeckter Tabaktrockenstadel. Die Böden des Raab- und Lafnitztales waren nämlich ausgezeichnet zum Tabakanbau geeignet. Durch dreimalige Ackerung und Düngung des feuchten Weidegrundes konnten in diesem Gebiet im 17. Jh. etwa 50.000 Pfund (ca. 23 Tonnen) Trockentabak pro Jahr geerntet werden. Die Blätter wurden in luftdurchlässigen Holzscheunen bzw. Trockenstadeln getrocknet und in St. Gotthard an der Raab weiterverarbeitet. Einer dieser Tabaktrockenstadel wurde 1975 vor dem Verfall gerettet und neu aufgestellt. Daneben stehen ein Kellerstöckl und eine alte Weinpresse (beides ebenfalls mit Stroh gedeckt). Im Inneren des Stadels befindet sich der Gedenkraum mit Bildern, Dokumenten, Exponaten und einer modernen audiovisuellen Darstellung der Schlacht und des Friedensweges. Der Gedenkraum ist ein optimaler Ausgangspunkt für die Wanderung auf dem Friedensweg, dessen Höhepunkt die Schlösslkapelle mit dem großen Kreuz bildet.
4.2 Friedensstein und Weißes Kreuz
Der Friedensweg führt zum westlichen Ortsbeginn von Mogersdorf, wo sich die Station "Friedensstein und Weißes Kreuz" befindet. Beide Monumente stellen besonders die Aussöhnung mit dem ehemaligen Feind in den Mittelpunkt.
Das Weiße Kreuz wurde am 26.7.1840, dem Tag der hl. Anna eingeweiht. Daneben standen zwei mächtige Hügel, die 1839 abgegraben wurden, wobei zahlreiche sterbliche Überreste der 1664 gefallenen Kämpfer gefunden wurden. Das Kreuz, das von der Bevölkerung oftmals auch "Türkenkreuz" genannt wird, wurde 1964 restauriert und ist seit dem Jahr 2002 denkmalgeschützt. In Ergänzung wurde im Sinne der heutigen Toleranz im Jahre 1984 daneben ein Gedenkstein für die toten türkischen Soldaten aufgestellt.
5. Weitere Gedenkstätten in Mogersdorf
5.1 Annakapelle
Unweit des Weißen Kreuzes steht die Annakapelle, die von der Witwe des in der Schlacht bei Mogersdorf gefallenen steirischen Generals Trauttmannsdorff gestiftet wurde. Der barocke Bau aus dem Jahr 1670 erinnert mit seinen zylindrischen Mauern und seinem kegelförmigen Dach an ein türkisches Zelt. Das Altarbild zeigt die hl. Mutter Anna mit ihrem Kind Maria und trägt eine lateinische Inschrift als Danksagung für die Befreiung von der Türkengefahr.
5.2 Deckengemälde in der Pfarrkirche
Die Römisch-katholische Pfarrkirche hl. Josef wurde 1775 erbaut. Am Triumphbogen der Kirche zeigt ein Fresko von Josef Rösch aus dem Jahr 1912 die Schlacht bei Mogersdorf. Am Himmel steht die Mutter Gottes mit dem Kind, wodurch der Künstler deren Beistand betonen wollte. Bei der Renovierung im Jahr 2014 wurden im gesamten Kirchenschiff umfangreiche Malereien mit Bezug auf die Türkenschlacht sichtbar gemacht.
* Titelfoto: Gedächtnisstätte auf dem Schlösslberg. Quelle: Schlösslverein Mogersdorf
 3993
3993 





 Architekt
Architekt Global: daibau.com
Global: daibau.com AT: daibau.at
AT: daibau.at CH: daibau.ch
CH: daibau.ch DE: daibau.de
DE: daibau.de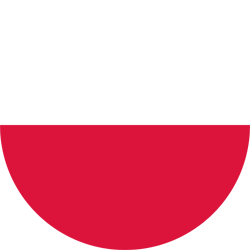 PL: daibau.pl
PL: daibau.pl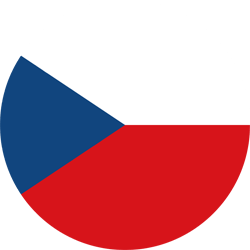 CZ: daibau.cz
CZ: daibau.cz SK: daibau.sk
SK: daibau.sk SI: mojmojster.net
SI: mojmojster.net HR: emajstor.hr
HR: emajstor.hr RS: daibau.rs
RS: daibau.rs BA: daibau.ba
BA: daibau.ba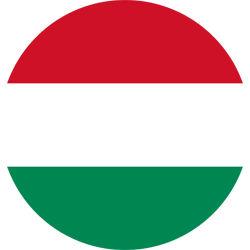 HU: daibau.hu
HU: daibau.hu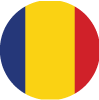 RO: daibau.ro
RO: daibau.ro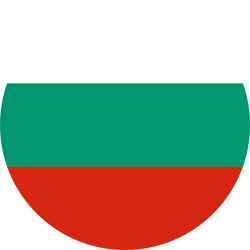 BG: daibau.bg
BG: daibau.bg