Im Beitrag:
1. Brandschutzwand
1.1 Was sind Brandschutzwände
Brandschutz wird in zwei Kategorien unterteilt. Die Erste ist der vorbeugende Brandschutz, der alle Maßnahmen umfasst, die der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorbeugen. In die zweite Kategorie gehört abwehrender Brandschutz, der die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten bei einem Brand ermöglicht. Ein elementarer Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes von Gebäuden sind Brandschutzwände (auch Brandwände, Brandmauern oder Feuermauern genannt). Das sind raumabschließende Bauteile, die so beschaffen sind, dass sie bei einem Gebäudebrand die Ausbreitung von Feuer und Rauch von einem Gebäude oder Gebäudeteil zu einem anderen über einen längeren Zeitraum verhindern (mehr dazu im Unterkapitel Feuerwiderstandsklassen). Brandwände müssen ihren Zweck auch dann noch erfüllen, wenn sie Löschwasser und Hitze ausgesetzt sind oder wenn andere Bauteile entweder von oben oder von der Seite auf sie herabstürzen. Besonders wichtig sind Brandschutzwände in dicht bebauten Städten bzw. Ortschaften mit geschlossener Bauweise. Sie verhindern nämlich, dass Feuer und Hitze auf benachbarte Gebäude übergreifen und Großbrände entstehen. Für Brandschutzwände gibt es aber auch andere Einsatzbereiche. So verhindern sie in Industrieanlagen das Übergreifen von Bränden auf andere Anlagenteile und tragen so zur Schadensbegrenzung bei. Weil Brandschutzwände einen Brand innerhalb des Gebäudes abschotten und dadurch die Entstehung von Brandabschnitten ermöglichen, können Menschen das Gebäude über nichtbetroffene Abschnitte verlassen oder in einem sicheren Gebäudeabschnitt auf die Einsatzkräfte zu warten.
1.2 Brandschutzwände in Trockenbauweise
Trockenbau gilt als Schlüsselgewerk im Innenausbau, deshalb muss diese Bauweise natürlich auch Lösungen für besondere Anforderungen bieten, wie beispielsweise für den Brandschutz. Brandwände in Trockenbauweise werden vor allem als nichttragende, innere Brandwände ausgeführt. Für diese Wände werden meist die klassischen, auf beiden Seiten mit Gips- oder Gipsfaserplatten beplankten Metallständer-Wandsysteme verwendet. Brandschutzwände müssen dicker als normale Raumtrennwände sein, weswegen sie beiderseits der aus Stahlprofilen bestehenden Unterkonstruktion mit zwei oder sogar drei Plattenlagen beplankt werden. Außerdem haben Trockenbau-Brandschutzwände auf beiden Beplankungsseiten eine durchgängige Stahlblecheinlage. Dieses Stahlblech verleiht diesen Brandschutzwänden ihre hohe Standsicherheit. Darüber hinaus können im Hohlraum zwischen beiden Beplankungsseiten nicht brennbare Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle) eingebaut werden. Solche Wände sind meist aus Materialien der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar ohne brennbare Bestandteile) oder A2 (nichtbrennbar mit brennbaren Bestandteilen) hergestellt.
1.3 Feuerwiderstandsklassen
Feuerwiderstandsklassen oder Brandschutzklassen beschreiben die Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen. Die Klassifizierung wird durch die europäische Norm DIN EN 13501 geregelt. Die Feuerwiderstandsklasse F60 bedeutet z. B., dass das Bauteil (in diesem Fall die Brandschutzwand) im Brandfall mindestens 60 Minuten seine Funktion erfüllt. Das heißt, dass in diesem Zeitraum alle wesentlichen Funktionseigenschaften der Wand (Tragfähigkeit, Undurchdringbarkeit für Flammen sowie Rauch, niedrige Oberflächentemperatur auf der dem Feuer abgewandten Bauteilseite) bewahrt bleiben müssen, auch wenn sie in dieser Zeit direkter Flammeneinwirkung und Löschwasser ausgesetzt ist. Nach der bauaufsichtlichen Benennung gilt F30 als feuerhemmend, F60 als hochfeuerhemmend, F90 als feuerbeständig, und F120 sowie F180 als hochfeuerbeständig.
2.Schallschutzwand
2.1 Was sind Schallschutzwände
Als Schallschutz werden Maßnahmen zur Minderung der Schallübertragung von der Schallquelle zum Empfänger bezeichnet. In Gebäuden dienen diesem Zweck elastische Flächen, die Trennung von Bauteilen, die Vermeidung von Schallbrücken und andere Maßnahmen. Die aus Sicht des Brandschutzes ungünstige geschlossene Bauweise kann für den Schallschutz von Vorteil sein, da sie unerwünschte Geräusche abschirmt. Auch für den Schallschutz im Wohnbau gibt es Regelungen, z. B. die ÖNORM B 8115-5 "Schallschutz und Raumakustik im Hochbau" und die OIB-Richtlinie 5 "Schallschutz ".
2.2 Schallschutzwände in Trockenbauweise
Wie das oben bereits beschrieben wurde, werden Trockenbauwände meistens mit Unterkonstruktionen aus Stahlblechprofilen und beidseitiger Beplankung aus Gipsplatten errichtet. Solche Montagewände in Innenräumen, die keine statischen Funktionen übernehmen, haben in der Mitte einen Hohlraum. Darin können Technikinstallationen (Elektrokabel und Rohre) untergebracht werden, er lässt sich aber auch mit Dämmstoffen füllen. Dadurch kann der Schall- und Brandschutz von Trockenbauwänden gleich gut oder sogar besser sein als der von massiven Wänden. Die U-förmigen Anschlussprofile der Unterkonstruktion werden schallentkoppelt an Boden und Decke befestigt, während C-förmige Tragprofile lose in die U-Profile einhängt werden. Weil die beiden äußersten dieser C-Profile die Raumwände berühren, werden sie ebenfalls mit einem Schaumstoff-Dämmstreifen schallentkoppelt. Es gibt Einfachständerwände und Doppelständerwände. Erstere verfügen nur über eine Metallständerebene, Letztere hingegen über zwei jeweils einseitig beplankte, parallele Ständereihen. Die Beplankungen sind zwei- oder mehrlagig. Bei Doppelständerwänden entstehen durch die voneinander getrennten Unterkonstruktionen zwei entkoppelte Wandschalen, was vor allem für den Schallschutz von Vorteil ist (Doppelständerwände lassen sich aber auch dazu nutzen, den Wärme- und Brandschutz durch stärkere Dämmstoffdicken zu erhöhen). Gipskartonplatten bieten bereits durch ihren biegeweichen Kern gute Voraussetzungen, um die Ausbreitung von Luftschall einzudämmen. Mithilfe von doppelten Ständerkonstruktionen, Zweifach-Beplankungen und zusätzlichen Dämmlagen im Hohlraum lassen sich hoch leistungsfähige Schallschutzwände errichten, die selbst Massivwände übertreffen.


 3188
3188  3188
3188 




 Global: daibau.com
Global: daibau.com AT: daibau.at
AT: daibau.at CH: daibau.ch
CH: daibau.ch DE: daibau.de
DE: daibau.de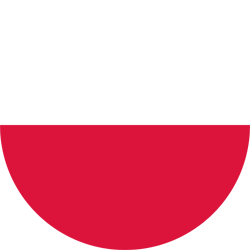 PL: daibau.pl
PL: daibau.pl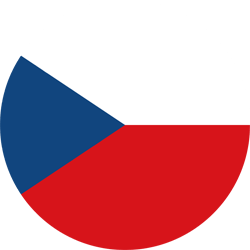 CZ: daibau.cz
CZ: daibau.cz SK: daibau.sk
SK: daibau.sk SI: mojmojster.net
SI: mojmojster.net HR: emajstor.hr
HR: emajstor.hr RS: daibau.rs
RS: daibau.rs BA: daibau.ba
BA: daibau.ba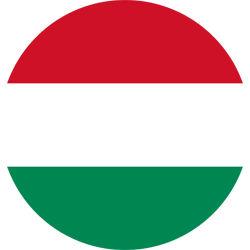 HU: daibau.hu
HU: daibau.hu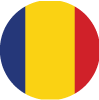 RO: daibau.ro
RO: daibau.ro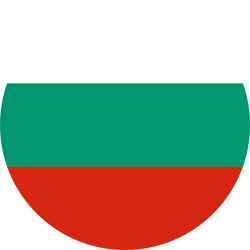 BG: daibau.bg
BG: daibau.bg