Im Beitrag:
1. Was ist ein Passivhaus?
Das Passivhaus ist keine neue Bauweise, sondern ein Bau- bzw. Gebäudestandard, bei dem das Gebäude passiv geheizt wird, erklärt man uns im Unternehmen Ing. Leopold Haselberger Ges.m.b.H. Das bedeutet, dass in der Regel kein Bedarf an einem aktiven Heizsystem, wie etwa einer klassischen, wassergeführten Zentralheizung, besteht. Der Grund dafür liegt zum einen in der hohen Wärmedämmung und zum anderen im Funktionsprinzip des Gebäudes (Wärmerückgewinnung der Abstrahlwärme von Bewohnern und Haushaltsgeräten, Reduzierung der Lüftungswärmeverluste mittels Wärmetauscher). Sogar im Winter reichen Sonne, Dämmung, innere Gewinne usw. aus, um im Gebäude eine angenehme Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.
Die Bezeichnung „passiv“ bedeutet, dass der Großteil des Wärmebedarfs aus passiven Quellen gewonnen wird (z. B. Sonneneinstrahlung und Abwärme von Personen und technischen Geräten). Die Gebäudehülle eines Passivhauses ist weitgehend luftdicht. Die Lüftung erfolgt über ein spezielles Belüftungssystem, das zwar Abluft nach außen ableitet, die Wärme aber ins Haus zurückführt.
Wie eingangs erwähnt, handelt es sich beim Passivhaus nicht um eine Bauweise, sondern um einen Bau- bzw. Gebäudestandard, der besondere Anforderungen bezüglich Architektur, Technik und Ökologie stellt. Deshalb können Passivhäuser in verschiedensten Bauweisen (Massiv-, Leicht- oder Mischbauweise) und mit allen Materialien (Holz, Lehm, Ziegel, Beton, Glas, Stahl usw.) gebaut werden. Aber auch bei Umbauten und Sanierungen kann dieser Standard erreicht werden.
Der Heizwärmebedarf (HWB) eines Passivhauses (auch Energiekennzahl – EKZ genannt) darf bei höchstens 15 kWh/m²a (Kilowattstunden pro Quadratmeter in einem Jahr) liegen. Diese Berechnung ist im PHPP-Standard (Passivhausprojektierungs-Paket des Passivhaus Instituts in Darmstadt) festgelegt und entspricht 10 kWh/m²a nach Richtline 6 des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB). Diese Werte gelten für eine Raumtemperatur von 20 °C.
2. Wie funktionieren Passivhäuser?
Die Energieeinsparung in Passivhäusern erfolgt hauptsächlich durch Minderung der Energieverluste (Transmissionswärmeverluste und Wärmeverluste durch Lüftung). Erreicht wird dies durch eine gute Wärmedämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung der Abstrahlwärme von Bewohnern und Haushaltsgeräten.
2.1 Wärmedämmung
Bei Passivhäusern müssen alle Umfassungsflächen (Dach, Wände Kellerwände, Fundamente, Fenster) sehr gut wärmegedämmt sein. Es darf keine Wärmebrücken und Undichtheiten geben (das gilt auch für die Anschlüsse).
Die Bauweise eines Passivhauses muss zwecks Wärmeverluste so kompakt wie möglich sein. Die Gebäudehülle muss hochgedämmt, luftdicht und wärmebrückenfrei sein, damit sie die gespeicherte Energie am Entweichen hindern kann. Gauben, Vorsprünge und ähnliche Elemente sind zu vermeiden, denn ein Passivhaus muss möglichst wenig wärmeübertragende Flächen aufweisen. Der Baukörper selbst kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wobei zu beachten ist, dass die Holzbauweise aufgrund der erforderlichen Dampfsperre etwas teurer ist. Die Luftdichtheit wird auch durch eine durchgehende luftdichte Ebene gewährleistet (meist durch den mit Fenstern, Türen, Bodenplatte und Dach luftdicht verbunden Innenputz).
Die Fenster sind mit 3-Scheiben Wärmeschutzverglasung ausgestattet. Sie haben selektive Schichten zu jedem Scheibenzwischenraum und sind mit Edelgas (meistens Argon) gefüllt.
Wenn solche Fenster nach Süden ausgerichtet sind, haben sie auch im Winter durch solare Energiegewinne eine positive Energiebilanz. Deshalb ist es wichtig, die Verteilung und Größe der Fenster richtig zu planen. Große Fenster gehören an die Südseite, während an allen anderen Seiten kleine Fenster eingebaut werden sollten. Daraus folgt, dass wenig beheizte Räume (z. B. Badezimmer) nach Norden, stärker beheizte Räume (z. B. Wohn- und Kinderzimmer) nach Süden ausgerichtet werden sollten. Solare Energiegewinne und Wärmeschutz lassen sich durch den Einbau von Fenstern mit möglichst schmalen Rahmen und zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln noch steigern. Selbstverständlich müssen die Fenster auch wärmebrückenfrei eingebaut werden.
Quelle: Ing. Leopold Haselberger Ges.m.b.H.
2.2 Lüftung
Zu den wichtigsten Bestandteilen eines Passivhauses gehört die Lüftungsanlage. Ihre Aufgabe ist es, die Frischluftzufuhr zu regeln und den Wärmeverlust zusätzlich zu reduzieren. Die zugeführte Frischluft wird durch einen Wärmetauscher unter Ausnutzung der im Haus vorhandenen Abwärme auf Raumtemperatur erwärmt.
Bei Bedarf kann über die Lüftungsrohre auch geheizt werden. Dazu wird z. B. eine elektrische Heizung eingesetzt, welche die Luft in den Lüftungsrohren erwärmt, bevor sie in den Raum abgegeben wird. Dadurch kann eine klassische Heizung im Passivhaus überflüssig werden.
Wichtig ist, dass das Haus luftdicht gebaut wird. Die extreme Luftdichtheit beeinträchtigt aber nicht das Raumklima. Ganz im Gegenteil: der Luftwechsel ist dank der Lüftungsanlage effizienter und regelmäßiger als beim Lüften durch geöffnete Fenster. Die Lüftungsanlage ermöglicht auch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Lüftung durch Fenster ist zwar möglich, aber überflüssig.
In einem Passivhaus herrscht das ganze Jahr über in allen Räumen eine gleichmäßige Temperatur von etwa 20 bis 22 °C. Auch innerhalb eines Raumes gibt es (fast) keine Temperaturunterschiede, weshalb sich sogar das Stehen oder Sitzen direkt neben dem Fenster behaglich anfühlt. Dies ist deswegen möglich, weil durch die extrem effektive, völlig wärmebrückenfreie Wärmedämmung sämtliche Oberflächentemperaturen höher sind als in einem herkömmlichen Haus. Falls Temperaturunterschiede in den Räumen gewünscht sind, kann das über die Einstellung der Lüftung geregelt werden.
Zusätzlich können in Passivhäusern auch Erdwärmeüberträger eingebaut werden. Das sind im Erdreich verlegte Wärmetauscher, welche die Luft über Schläuche oder Rohre durch das Erdreich transportieren und sie dessen Temperatur anpassen. Auf diese Weise kühlen sie das Passivhaus im Sommer und wärmen es im Winter.
2.3 Heizungssysteme
Wassergeführte Heizungssysteme werden in Passivhäusern ergänzend oder zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit eingebaut. Zum Einsatz kommen sie meist nur bei sehr niedrigen Außenlufttemperaturen. Die Zuheizung erfolgt mithilfe elektrischer Heizregister oder einer elektrisch betriebenen Luft-Luft-Wärmepumpenheizung über die Lüftungsanlage. Vor allem in Badezimmern werden oft elektrische Fliesenheizungen angewandt. Diese Maßnahmen steigern natürlich den Verbrauch der elektrischen Energie.
Aufgrund der Luftdichtheit kann in einem Passivhaus kein herkömmlicher Kamin eingebaut werden. Das durch die Außenwand geführte Ofenrohr stellt nämlich eine Wärmebrücke dar. Außerdem ist der Sauerstoffverbrauch zu hoch für das luftdichte Passivhaus. Kaminliebhaber müssen auf das Vergnügen, gemütlich am Kamin zu sitzen dennoch nicht verzichten, denn spezielle Kamine, wie z. B. Ethanolkamine lösen das Problem.
3. Vor- und Nachteile von Passivhäusern
Der offensichtlichste Vorteil von Passivhäusern sind die niedrigen laufenden Betriebskosten. Im Unternehmen Ing. Leopold Haselberger Ges.m.b.H. wird uns erklärt, dass Passivhäuser Wohnkomfort mit einem verschwindend geringen Energieverbrauch verbinden. Es besteht auch kein Bedarf nach einer herkömmlichen Heizung. Die Raumtemperatur bleibt das ganze Jahr hindurch konstant und weil nicht durch offene Fenster gelüftet wird, gelangen Staub und Pollen nicht ins Haus. Deswegen sind Passivhäuser für Allergiker sehr gut geeignet. In den luftdicht gebauten Häusern besteht auch kaum die Gefahr eines Feuchte- oder Schimmelschadens. Passivhäuser haben eine gute Ökobilanz, sind jedoch nicht zwangsläufig ökologisch. Weil für die Baukonstruktion und die Wärmedämmung unterschiedliche Materialien verwendet werden können, besteht auch die Möglichkeit des Einbaus nicht umweltfreundlich hergestellter Materialien (z. B. EPS-Platten für die Wärmedämmung). Außerdem sind Passivhäuser gewöhnungsbedürftig (sie bieten z. B. kein fühlbares Wärmeerlebnis). Es gibt auch architektonische Einschränkungen (die Bauweise muss möglichst kompakt sein). Ein für jeden Bauherrn wichtiger Faktor sind die Baukosten. Diese sind bei Passivhäusern zwar höher als bei herkömmlichen Häusern, andererseits wird dieser energiesparendste Baustandard von den Bundesländern gefördert.


 1733
1733  1733
1733 




 Global: daibau.com
Global: daibau.com AT: daibau.at
AT: daibau.at CH: daibau.ch
CH: daibau.ch DE: daibau.de
DE: daibau.de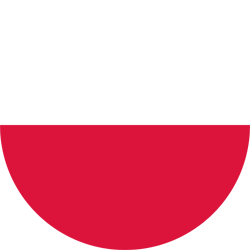 PL: daibau.pl
PL: daibau.pl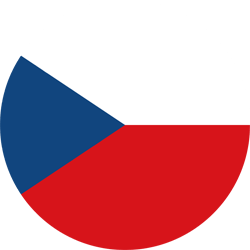 CZ: daibau.cz
CZ: daibau.cz SK: daibau.sk
SK: daibau.sk SI: mojmojster.net
SI: mojmojster.net HR: emajstor.hr
HR: emajstor.hr RS: daibau.rs
RS: daibau.rs BA: daibau.ba
BA: daibau.ba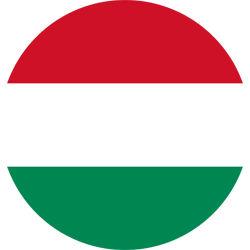 HU: daibau.hu
HU: daibau.hu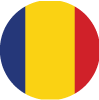 RO: daibau.ro
RO: daibau.ro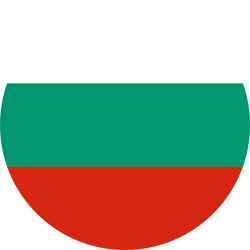 BG: daibau.bg
BG: daibau.bg