Im Beitrag:
1. Was ist eine Wärmebrücke?
1.1 Wärmebrücken verursachen Wärmeverluste
Eine Wärmebrücke (umgangssprachlich auch Kältebrücke genannt) ist ein Bereich im Baukörper bzw. in der Gebäudehülle, in dem die Wärmeübertragung vom Gebäude an die Umgebung höher ist als in den angrenzenden Bauteilen (die Gründe dafür werden weiter unten näher erörtert). Wärmebrücken können den Bewohnern oder Eigentümern des Gebäudes viele Kopfschmerzen bereiten, da sie zu höheren Heizkosten führen. Zudem wird durch den höheren Energieverbrauch die Umweltbelastung durch das Gebäude erhöht.
2. Warum bilden sich Wärmebrücken?
Die Gründe für die Entstehung von Wärmebrücken sind vielfältig und zahlreich. Meistens entstehen sie dort, wo sich zwei unterschiedliche Materialien berühren. Wärmebrücken können aber auch aufgrund der speziellen Geometrie des Bauwerks entstehen, weil es große Unterschiede in der Dicke der verbauten Materialien oder ihrer Wärmeleitfähigkeit gibt (so besitzen z. B. Holz und Beton eine sehr unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit). Der dritte Grund für die Entstehung von Wärmebrücken sind Fehler beim Erstellen des Ausführungsplans oder beim Bau des Gebäudes. Auch wenn die Wärmedämmung schlecht angebracht, nicht fertiggestellt oder bei der Verlegung von Installationen durchbrochen wird, kann als Folge eine Wärmebrücke auftreten.
3. Arten von Wärmebrücken
3.1 Materialbedingte Wärmebrücke
Materialbedingte Wärmebrücken entstehen dort, wo Materialien mit unterschiedlich hoher Wärmeleitfähigkeit nebeneinander verbaut sind. Für die Entstehung von Wärmebrücken sind natürlich Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit verantwortlich. Insbesondere Metalle sind allgemein sehr gut wärmeleitend, weshalb z. B. in eine Betonwand eingelassene Stahlträger ein potenzielles Risiko darstellen. Andere Bereiche, an denen sich materialbedingte Wärmebrücken bilden, sind Mörtelfugen in Ziegelwänden, durchfeuchtete Bereiche in der Wärmedämmung und Fensterstürze in einer Mauerwerksaußenwand.
3.2 Geometrische Wärmebrücke
Die zweite Wärmebrückenart sind geometrische Wärmebrücken, die dann auftreten, wenn die wärmeaufnehmende Innenoberfläche und die wärmeabgebende Außenoberfläche eines Bauteils unterschiedlich groß sind. Solche Stellen in der Gebäudekonstruktion sind z. B. Ecken, Dachgauben, Kanten oder Vorsprünge in den Gebäudeaußenwänden. Weil im Kantenbereich mehr Wärme abfließt als im ungestörten Wandbereich, ist die Oberflächentemperatur in der Kante niedriger ist als die der restlichen Wandoberfläche. Geometrische Wärmebrücken lassen sich nicht vollständig vermieden, allerdings können sie durch einen kompakten Baukörper und gute Wärmedämmung reduziert werden.
3.3 Konstruktive Wärmebrücke
Konstruktive Wärmebrücken treten dort auf, wo die thermische Gebäudehülle gestört ist. Sie entstehen z. B. dann, wenn eine Stahlbetondecke durch die Wärmedämmung nach außen als Balkonplatte geführt wird oder wenn durch eine Innenwand die Innendämmung der Außenwand unterbrochen wird. Eine ähnliche Situation besteht, wenn die Kellerdecke von unten gedämmt wird und in den Kellerwänden Wärmebrücken auftreten. Konstruktive Wärmebrücken entstehen also durch eine bauliche Notwendigkeit oder durch planerische Zwänge, können aber in vielen Fällen durch eine gute Außendämmung vermieden werden.
3.4 Konvektive Wärmebrücke
Manchmal trifft man auch auf den Ausdruck „konvektive Wärmebrücke“. Damit sind Wärmebrücken gemeint, die durch undichte Fenster, Türen und sonstigen Fugen sowie Durchführungen von Versorgungsleitungen in der Außenwand oder in raumabschließenden Bauteilen entstehen. Besonders im Dachbereich ist die Gefahr des Auftretens konvektiver Wärmebrücken hoch. Um dies zu vermeiden, muss die Gebäudehülle luftdicht sein. Die Luftdichtigkeit kann durch das Blower-Door-Verfahren geprüft werden.
4. Folgen von Wärmebrücken
Wärmebrücken verursachen Wärmeverluste und andere Probleme im Gebäude. Großflächige Wärmebrücken müssen vermieden bzw. abgemildert werden, da sie die Bauteile beschädigen können. Als Folge von Wärmebrücken können verschiedene negative Erscheinungen auftreten, wie z. Korrosion, Abblättern des Putzes, Schimmelbildung, Pilzbefall und im Extremfall sogar der Verlust der Tragfähigkeit.
4.1 Erhöhter Energieverbrauch
Wie bereits erwähnt, führen Wärmebrücken zu einem erhöhten Verbrauch von Heizenergie. Wenn die Oberfläche eines Bauteils aufgrund des Vorhandenseins einer Wärmebrücke kälter ist, muss die Raumlufttemperatur höher sein. Um den üblichen thermischen Komfort zu erreichen, muss das Gebäude also stärker geheizt werden. Dadurch steigen die Heizkosten und die Belastung der Umwelt nimmt zu.
4.2 Minderung des thermischen Komforts
Darüber hinaus beeinträchtigen Wärmebrücken den thermischen Komfort im Gebäude. Das Problem tritt vor allem im Winter auf, wenn die mit Wärmebrücken belasteten Stellen auf der Wandinnenseite kälter sind als die Stellen ohne Wärmebrücke. Dadurch entsteht eine Luftbewegung im Raum (Zugluft), die für Menschen spürbar ist. Üblicherweise beseitigen die Bewohner dieses Phänomen, indem sie stärker heizen, was die Heizkosten zusätzlich erhöht.
4.3 Feuchtigkeitsansammlung und Schimmelbefall
Eine Wärmebrücke kann auch dazu führen, dass sich an den Innenflächen der äußeren Gebäudewand Kondenswasser ansammelt. An jenen Stellen an der Wandinnenseite, an denen sich Wärmebrücken gebildet haben, ist die Temperatur niedriger. Die Warme Raumluft kühlt an der kalten Wandoberfläche ab und es kommt zur Kondensation. Zudem setzt sich im Kondenswasser Staub fest. Diese Stellen bieten wiederum günstige Bedingungen für Sporen oder Schimmelpilze. Dieses Phänomen kann abgemildert werden, indem eine Raumluftfeuchtigkeit von 35 bis 65 % aufrechterhalten wird.
4.4 Verfall der Gebäudekonstruktion
Wie oben beschrieben, kann das Vorhandensein einer Wärmebrücke auch zum Ansammeln von Feuchtigkeit führen. Langfristig jedoch führt Feuchtigkeit in Bauteilen dazu, dass diese beschädigt oder gar zerstört werden. Je stärker die Wirkung der Wärmebrücke, desto stärker kühlt das Bauteil ab, und desto stärker wird es durchfeuchtet. Dadurch wird die Wirkung der Wärmebrücke noch weiter verstärkt.


 Fachartikel
Fachartikel  1398
1398  Fachartikel
Fachartikel  1398
1398 





 0
0 Global: daibau.com
Global: daibau.com AT: daibau.at
AT: daibau.at CH: daibau.ch
CH: daibau.ch DE: daibau.de
DE: daibau.de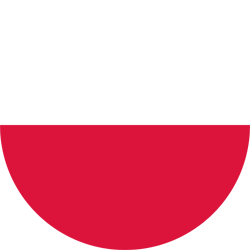 PL: daibau.pl
PL: daibau.pl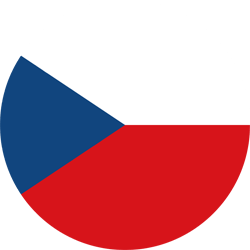 CZ: daibau.cz
CZ: daibau.cz SK: daibau.sk
SK: daibau.sk SI: mojmojster.net
SI: mojmojster.net HR: emajstor.hr
HR: emajstor.hr RS: daibau.rs
RS: daibau.rs BA: daibau.ba
BA: daibau.ba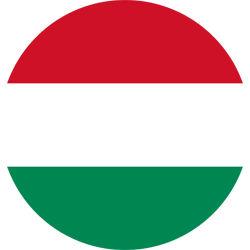 HU: daibau.hu
HU: daibau.hu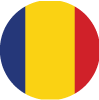 RO: daibau.ro
RO: daibau.ro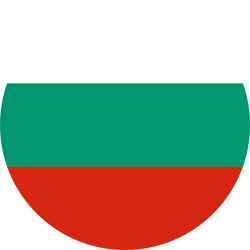 BG: daibau.bg
BG: daibau.bg