1. Dachbodendämmung
1.1 Warum ist Dachbodendämmung notwendig?
Ein Haus sollte vom Keller bis zum Dach vollständig wärmegedämmt sein. Der Dämmung des Dachbodens fällt hierbei besondere Bedeutung zu, denn in diesem Bereich lässt sich viel zur Verringerung des Energieverbrauchs eines Gebäudes beitragen. Weil warme Luft bekanntlich aufsteigt, können nämlich über ein ungedämmtes Dach bis zu 20 Prozent der verbrauchten Heizungsenergie verloren gehen. Dämmmaßnahmen in diesem Gebäudebereich wirken sich daher besonders effektiv aus und angesichts des gestärkten Umweltbewusstseins und steigender Energiepreise kann auf eine Dachbodendämmung daher nicht verzichtet werden.
1.2 Dachschrägendämmung und Dämmung der obersten Geschossdecke
Die gute Nachricht ist, dass Dämmmaßnahmen in diesem Gebäudebereich nicht nur effizient, sondern auch sehr günstig sind. Im Bereich des Dachraumes wird zwischen der Dämmung der Dachschrägen und der Dämmung der obersten Geschossdecke (Dachfußboden) unterschieden. Die erste Variante ist dann sinnvoll, wenn der Dachboden ausgebaut und das Dach beheizt werden soll. In diesem Fall ist eine komplette Dachdämmung nötig, um im Dachgeschoss sowie im restlichen Gebäude ein angenehmes Wohnklima zu erzielen und Energieverluste zu vermeiden.
1.3 Dämmung der obersten Geschossdecke – die Vorteile
Sofern das Dachgeschoss des Hauses nicht als Wohnraum, sondern lediglich als Stauraum genutzt wird (oder im Falle eines nicht genutzten Spitzbodens), ist es ratsamer, lediglich eine Dachbodendämmung bzw. die Dämmung der obersten Geschossdecke vorzunehmen und das Dach in seinem ursprünglichen Zustand zu belassen. Die Dachbodendämmung kann schnell (sie erfordert nur wenige Stunden Arbeit), unkompliziert und kostengünstig ausgeführt werden. Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist auch wesentlich effizienter als die Dachflächendämmung, da die Dachflächen viel größer sind als die Deckenfläche. Außerdem kommen bei einer Dachflächendämmung noch Giebelflächen und Dachflächenfenster hinzu, die ebenfalls wärmeeffizient sein müssen. Deswegen kann in Gebäuden, in denen das Dachgeschoss nicht bewohnt wird, das gleiche Ziel (Dämmung des unterhalb der obersten Geschossdecke liegenden Wohnraumes) mit einem sehr viel geringeren Material- und Kostenaufwand erreicht werden. Der Ausbau des Dachgeschosses einschließlich der Montage einer vollständigen Dachdämmung ist nach einer Dachbodendämmung immer noch zu jedem Zeitpunkt möglich.
2. Dämmstoffe
Eine Dachbodendämmung stellt keine besonderen Anforderungen an die Dämmstoffe. Zur Anwendung kommen Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle), Hartschaumplatten auf Polystyrol-Basis (meist EPS bzw. expandiertes Polystyrol) oder natürliche Dämmstoffe wie z. B. Zellulose oder Hanf. Je nach Dämmvariante kommen plattenförmige, schüttfähige oder einblasbare Dämmstoffe zum Einsatz.
Welche Dämmmaterialien eingesetzt werden, hängt vor allem davon ab, ob der Dachboden in Zukunft begehbar sein soll. Falls der Dachfußboden nicht mehr begangen wird, genügen einfache offen verlegte Dämmmatten oder -platten aus Steinwolle, Glaswolle, Holzfaser oder Styropor, die einfach ausgerollt werden. Wenn der Dachboden jedoch als unbeheizter Stauraum dienen soll oder Sie gar darüber nachdenken, ihn irgendwann zu einer Dachgeschosswohnung auszubauen, muss das eingesetzte Dämmmaterial begehbar, also auch druckfest sein. In diesem Fall wird am besten Styrodur oder Polyethylen mit einer oberseitigen Abdeckung aus Spanplatten oder OSB-Platten eingesetzt. Mittlerweile sind auch gehfertige Dachbodenelemente erhältlich. Die Bauweise der Decke spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: hohle Holzbalkendecken werden mit losem Dämmmaterial gedämmt, offenen Holzdecken mit Schüttgut, geschlossene Holzdecken mit Einblasdämmstoffen, bei Betondecken und anderen geschlossenen Decken kommen dagegen am häufigsten Platten oder Matten zum Einsatz.
3. Die drei Arten der Dachbodendämmung
Bei der Dachbodendämmung bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke wird zwischen drei unterschiedlichen Vorgehensweisen unterschieden: Unter-, Zwischen- und Aufdeckendämmung. Die geeignete Variante wird je nach Gegebenheiten ausgewählt, trotzdem ist die Aufdeckendämmung die verbreitetste Variante.
3.1 Unterdeckendämmung
Bei dieser Vorgehensweise wird der Dachfußboden vom bewohnten Raum darunter aus gedämmt. Das bedeutet, dass die Dämmung an die Decke des darunterliegenden Raumes angebracht wird, dessen Höhe sich dadurch natürlich verringert. Damit das Dämmmaterial nicht feucht wird, muss an der Warmseite eine Dampfbremse angebracht werden, welche die Dämmschicht luftdicht zum beheizten Raum hin abschließt. Die Gefahr der Entstehung von Wärmebrücken ist bei einer Unterdeckendämmung sehr hoch.
3.2 Zwischendeckendämmung
Die Zwischendeckendämmung ist besonders gut für Fußböden aus Holzbalken geeignet. Bei dieser Dämmvariante werden Einblasdämmstoffe (meist Zellulose, Holzfaser oder Mineralwolle) dazwischen montiert oder Blähglasgranulat als Trockenschüttung verwendet. Auf diese Weise entsteht eine dichte Dämmschicht, die auch schalldämmend wirkt. Falls der so gedämmte Dachboden begehbar sein soll, werden auf der Holzbalkendecke Fußbodenverlegeplatten (OSB-Platten) verlegt. Um die Trittschallübertragung zu minimieren und Knarzgeräusche aufeinander reibender Hölzer zu vermeiden, müssen zwischen den Holzbalken und den darauf verschraubten Verlegeplatten spezielle Folien gelegt werden.
3.3 Aufdeckendämmung
Wie oben erwähnt, wird diese Dämmvariante am häufigsten angewandt. Dabei muss zuerst entschieden werden, ob der Fußboden vollständig, teilweise oder nicht begehbar sein soll. Die begehbare Variante ist spürbar teurer und aufwendiger, erfordert aber immer noch deutlich weniger Aufwand als Unter- oder Zwischendeckendämmung.
Nicht begehbare Dachbodendämmung
Die nicht begehbare Dachbodendämmung ist die einfachste Variante der Aufdeckendämmung und wird etwa bei Kriechböden ausgeführt. Dabei muss zuerst entschieden werden, ob eine Dampfbremse eingebaut werden soll. Diese ist vor allem bei Holzbalkendecken empfehlenswert. Eine Dampfbremse ist eine luftdichte Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmschicht vordringen und sie befeuchten kann. Dadurch könnte nämlich die Dämmwirkung der Dämmschicht beeinträchtigt werden, oder es könnte sogar zur Schimmelbildung kommen. Damit die Folie einwandfrei ausgelegt werden kann, muss die Oberfläche des Dachfußbodens zuvor gereinigt werden.
Nach dem Verlegen der Dampfbremse wird die Dämmung angebracht. Dabei können sowohl Dämmmatten als auch Dämmplatten zum Einsatz kommen. Um die Fugendichte zu gewährleisten, werden die Dämmmatten oder -platten meist zweilagig übereinander geschichtet. Dabei werden die Fugen versetzt, damit keine Wärmebrücken entstehen. Als Dämmmaterialien eignen sich Dämmstoffe wie Steinwolle oder organische Fasern. Auch Schüttdämmstoffe können zur Dachbodendämmung eingesetzt werden.
Begehbare Aufdeckendämmung
Die begehbare Aufdeckendämmung wird z. B. dann ausgeführt, wenn eine Nutzung des Dachbodens als Wohnraum vorgesehen ist. Dabei werden robuste Dämmplatten unter den Bodenplatten des Fußbodens verlegt. Auch in diesem Fall muss die Verlegung zweilagig und fugenversetzt erfolgen. Anschließend werden die normalen Fußbodenbretter montiert.
Teilweise begehbare Aufdeckendämmun
Eine teilweise begehbare Aufdeckendämmung wird benötigt, wenn der Dachboden nicht für eine Nutzung vorgesehen ist, aber trotzdem technische Einrichtungen, Fenster oder Kamine erreicht werden müssen. Deshalb werden in solchen Fällen mithilfe einer Steinwolldämmung mit hoher Druckfestigkeit Laufwege geschaffen. Nicht betretbare Flächen können mit Dämmstoffen aus Glaswolle vor Wärmeverlusten geschützt werden. Ein so gedämmter Dachboden ist teilweise begehbar und optimal gedämmt.


 Fachartikel
Fachartikel  2756
2756  Fachartikel
Fachartikel  2756
2756 





 1
1 Global: daibau.com
Global: daibau.com AT: daibau.at
AT: daibau.at CH: daibau.ch
CH: daibau.ch DE: daibau.de
DE: daibau.de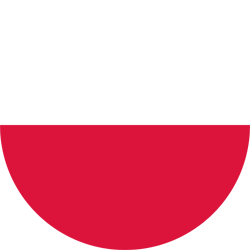 PL: daibau.pl
PL: daibau.pl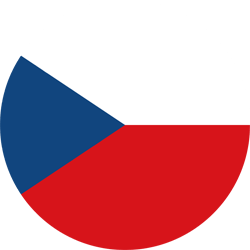 CZ: daibau.cz
CZ: daibau.cz SK: daibau.sk
SK: daibau.sk SI: mojmojster.net
SI: mojmojster.net HR: emajstor.hr
HR: emajstor.hr RS: daibau.rs
RS: daibau.rs BA: daibau.ba
BA: daibau.ba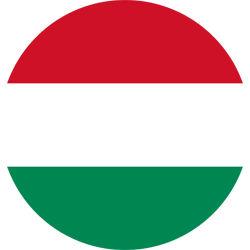 HU: daibau.hu
HU: daibau.hu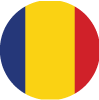 RO: daibau.ro
RO: daibau.ro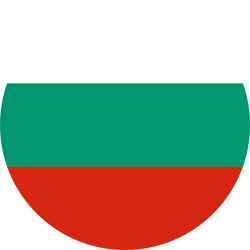 BG: daibau.bg
BG: daibau.bg